Alle kennen sie: die Eigenständigkeitserklärung am Ende einer wissenschaftlichen Arbeit. Mit der Verfügbarkeit generativer KI wurden diese Dokumente häufig um einen Passus ergänzt: Studierende versichern nun, dass sie KI-Tools nur nach Regeln guter wissenschaftlicher Praxis eingesetzt haben.
Doch was bedeutet das konkret für Ihre Lehre? Diese formale Anpassung lässt die entscheidenden Fragen für uns als Lehrpersonen offen:
Dieser Beitrag gibt Ihnen einen praxisnahen Überblick über verschiedene Formen der KI-Dokumentation. Er versteht sich nicht als verbindliche KI-Richtlinie, sondern als didaktische Orientierungshilfe für Lehrpersonen, die den KI-Einsatz in ihren eigenen Lehrveranstaltungen transparent gestalten möchten und nach individuell gestaltbaren Lösungen für Ihre Lehrpraxis suchen. Ziel ist es, dass Sie am Ende eine für Ihre Lehrveranstaltung passende Vereinbarung erstellen und sinnvoll in Ihr Lehrkonzept integrieren können.
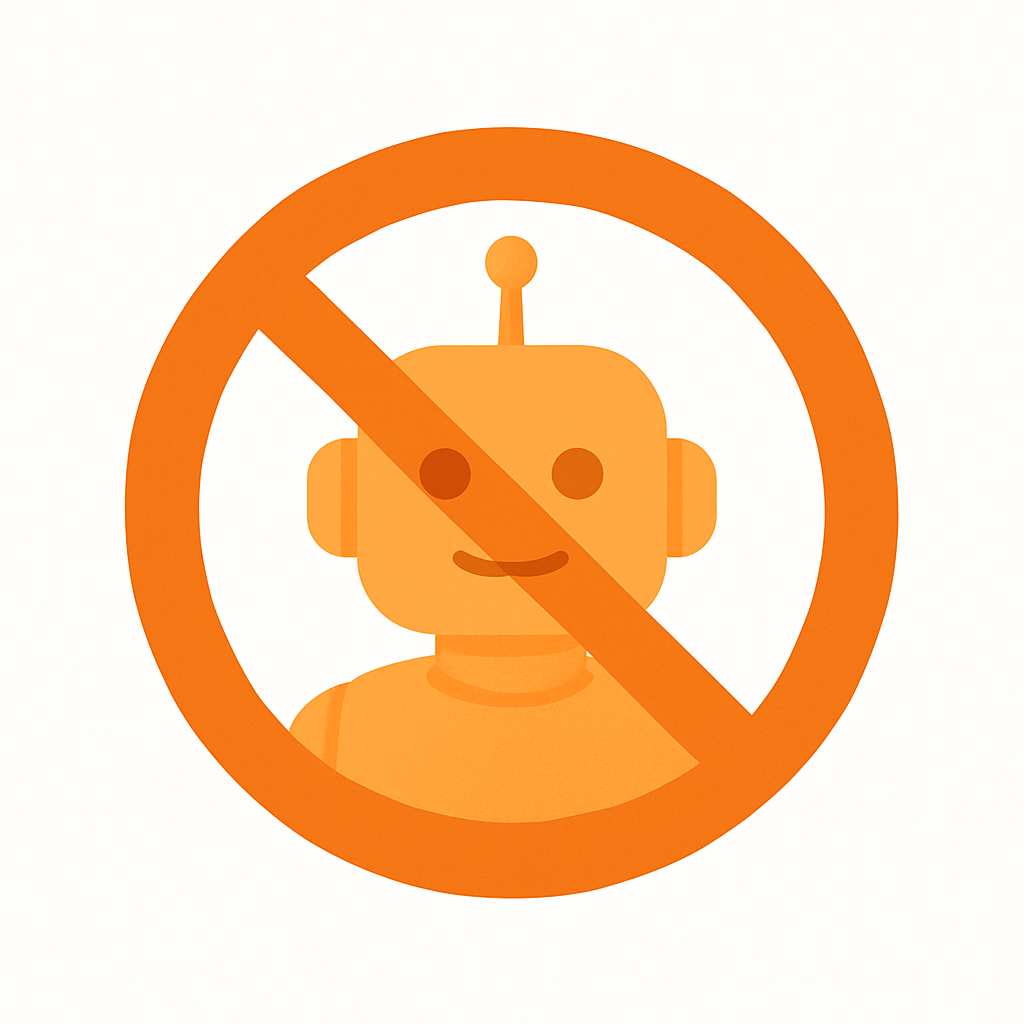
Der naheliegendste Gedanke mag ein generelles Verbot von KI-Tools sein. Doch dieser Ansatz ist nicht nur zunehmend realitätsfern, sondern auch kaum praktikabel. Die Einhaltung eines solchen Verbots lässt sich mit aktueller Software zur Plagiatsprüfung nicht zuverlässig kontrollieren. Vielmehr noch würde ein umfassendes Verbot die didaktische Chance vergeben, Studierende im kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit KI-Technologien anzuleiten und sie auf eine von digitalen Technologien geprägte Wissens- und Arbeitswelt vorzubereiten.
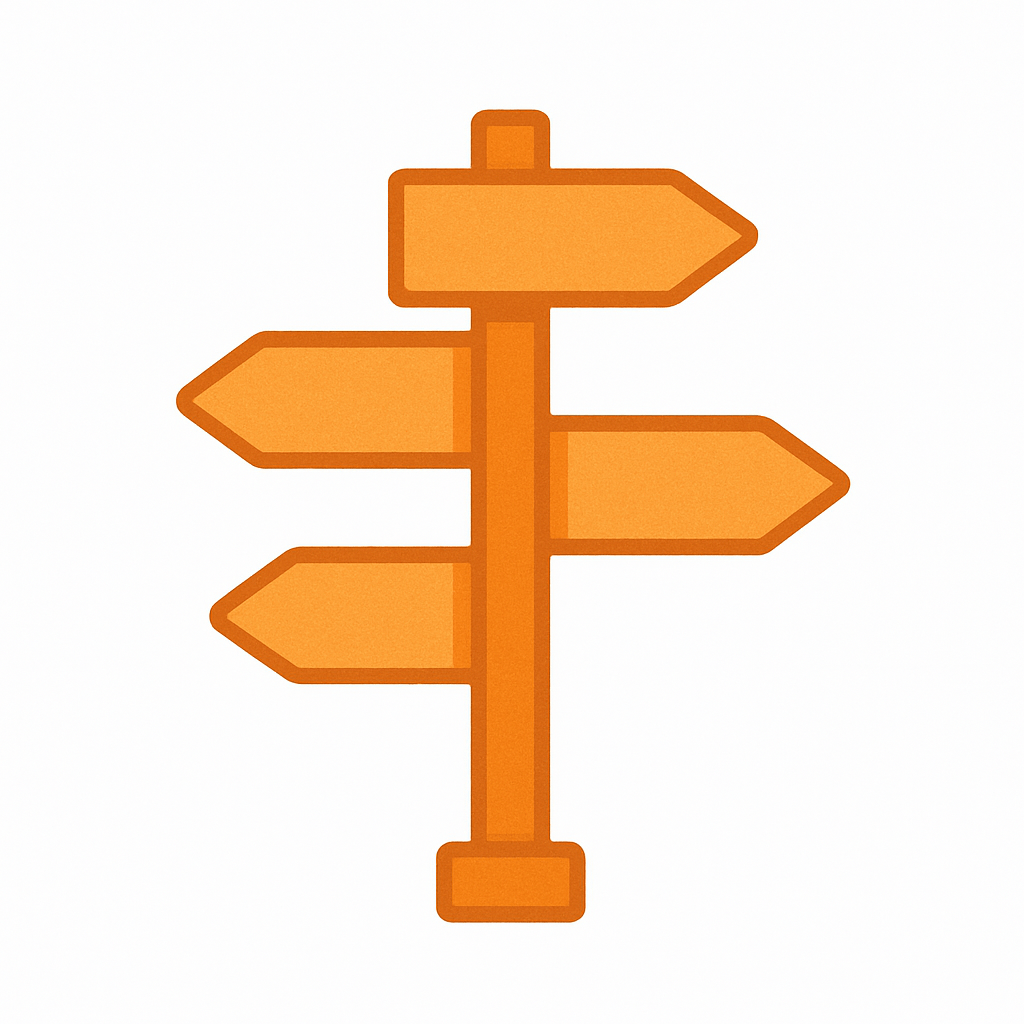
Statt eines Verbots ist eine transparente Regelung in der Regel sehr sinnvoll. Die Art der Dokumentation, die Sie von Ihren Studierenden verlangen, sollte dabei direkt von Ihren Lehrzielen abhängen. Grundsätzlich lassen sich vier grundlegende Ansätze unterscheiden (vgl. Baresel et al. 2024): holistisch – werkzeugorientiert – arbeitsphasenorientiert – reflexionsorientiert
Wichtiger Hinweis: Von einer reinen Auflistung aller genutzten Prompts oder der komplett generierten Texte wird durchwegs abgeraten. Der Fokus sollte auf dem Prozess und der kritischen Auseinandersetzung liegen, nicht auf der lückenlosen Protokollierung. [1,2]
> Die holistische Dokumentation: Der pragmatische Ansatz
Diese Form entspricht der gängigen Praxis, Eigenständigkeitserklärungen pauschal um einen zusätzlichen Absatz zu ergänzen. Darin versichern Studierende, dass ihre wissenschaftliche Eigenleistung durch den KI-Einsatz nicht beeinträchtigt wurde, und beschreiben kurz die Art der Nutzung. Die genaue Ausgestaltung dieser Beschreibung liegt dabei in der alleinigen Verantwortung der Studierenden; detaillierte Vorgaben fehlen hier in der Regel.
> Die werkzeugorientierte Dokumentation: Die als tabellarische Tool-Liste
Bei diesem Ansatz listen Studierende die von ihnen genutzten KI-Werkzeuge tabellarisch auf. Zu jedem Tool wird präzise beschrieben, für welchen Zweck es eingesetzt wurde (bspw. Perplexity zur Literaturrecherche, ChatGPT zur sprachlichen Überarbeitung).
> Die arbeitsphasenorientierte Dokumentation: Das prozessorientierte Protokoll
Hier orientiert sich die Dokumentation entlang des erforderlichen Arbeitsprozesses zur Erstellung der wissenschaftlichen Arbeit. Die Studierenden legen für jede Phase (z. B. Themenfindung, Recherche, Schreibprozess, Überarbeitung) dar, welches KI-Tool sie in welchem Umfang genutzt haben. Dies kann durch eine graduelle Einschätzung ergänzt werden, etwa von rein „unterstützend“ bis „inhaltsgestaltend“.
> Die reflexionsorientierte Dokumentation: Eine Erweiterung um Reflexionsfragen
Diese Form verbindet den werkzeugorientierten und arbeitsphasenorientierten Ansatz und erweitert sie um eine weitere Komponente: Reflexionsfragen. Studierende beantworten gezielte Fragen zu ihrem Arbeitsprozess und bewerten kritisch den Beitrag der KI. Dieser Ansatz entfaltet sein volles Potenzial in Lehrkonzepten, in denen lernprozessbegleitende Formen (u.a. Portfolio) eingesetzt werden. Die Voraussetzung hierfür ist, dass der Erwerb von KI-bezogenen Kompetenzen ein explizit formuliertes Lehrziel der Veranstaltung ist.

Bevor Sie sich für eine Dokumentationsart entscheiden, müssen Sie für sich selbst Klarheit schaffen: Was genau ist in meiner Lehrveranstaltung erlaubt und was nicht? Ein mögliches Tool, dass Sie dafür nutzen können, ist dieser KI-Policy-Generator (Universität Bamberg, 2025). Sie werden Schritt für Schritt durch verschiedene relevante Fragen geleitet und dabei unterstützt, aus editierbaren Textbausteinen eine klare und transparente KI-Richtlinie für Ihr Lehrangebot zusammenzustellen.
Dieser Schritt der Reflexion ist die Grundlage für jede Form der Kennzeichnung. Erst wenn Sie Ihre eigenen Regeln definiert haben, können Sie diese sinnvoll an die Studierenden kommunizieren und eine passende Dokumentationsmethode auswählen.
Ein Beispiel für eine mit dem KI-Policy-Generator erstellte KI-Richtlinie (werkzeugorientierte Dokumentation) für eine Lehrveranstaltung von Jonas Scharfenberg finden Sie hier. Zudem können Sie sich im Folgenden eine editierbare Beispielvorlage für eine prozessorientierte Dokumentation herunterladen.
Fragen zur Lehre mit generativer KI oder zur Integration der KI-Richtlinie in das eigene Lehrkonzept?
Das Zentrum für Lehrkräftebildung unterstützt Lehrende in der Lehrkräftebildung mit Formaten wie “DiLab für Lehrende”, individueller Beratung und Lehrkooperationen. Kontakt: verena.koestler@uni-passau.de
